Zur Buchvorstellung // Zur Buchserie
Leseprobe aus Kapitel 20 „Die Reise zu den Crozets“:
Sieben Beaufort aus Nordwest. Nach zweistündigem Kampf gegen Wind und Kelp, das dreimal die Kühlwasserpumpe der Hauptmaschine verstopft – sie muß jedesmal ausgebaut und gereinigt werden –, ist der Anker endlich oben. Bis zu den Crozet-Inseln liegen rund 600 Seemeilen gen Osten vor uns. Die Bordzeit wird um zwei Stunden vorgestellt. In der Nacht wechselnde Windstärken, manchmal prächtiger Sternenhimmel. Gegen Mittag beruhigt sich die See, der Wind raumt und läßt nach, wir tauschen Fock gegen Genua und machen gute Fahrt.Günthers Wetterfax zeigt ein Sturmtief auf 55° Süd und 04° West. Brian auf Marion ist mit auf Frequenz; leider können wir ihn nicht hören, weil Marion noch zu nahe ist. Günther vermittelt und gibt Brian auch unsere Position durch.
Peters Koje ist zusammengebrochen. Plötzlich lag er auf den darunter gestauten Dosen und Eiern, die auf wundersame Weise heil geblieben sind. Um den Schaden zu beheben, müssen Koje und Schapps ausgeräumt werden. Der Salon wird vorübergehend zur Baustelle, auf der Erich, Peter und Steffen mit der vom Generator betriebenen 220-Volt-Bohrmaschine, mit Säge und Hammer hantieren.
Am späten Abend herrliche raume Winde um vier Beaufort. Wir setzen den Blister. Keine fünf Minuten später fallen Starkwindböen ein und werfen die Freydis kräftig auf die Seite. Alles, was im Schiff nicht niet- und nagelfest ist, purzelt durch die Gegend. Glücklicherweise ist die Kojenreparatur beendet. In aller Eile wird der Riesenflügel wieder eingezogen.
Wind aus Nordnordwest, sechs bis sieben Beaufort, trübes, graues Wetter, aber nicht so kalt wie in den letzten Tagen. Gegen Mittag klart es ein wenig auf. Ich kämpfe mal wieder mit Frischfleisch. Hans hat uns ein halbes tiefgefrorenes Rind eingepackt, in Form von Burenwurst, Spearribs, Roastbeef und Filets. Mein Backofen arbeitet rund um die Uhr auf Hochtouren, es duftet im Schiff wie in einer Gourmetküche.
Am Nachmittag nimmt der Wind etwas ab. Erhard und Burkhard, beide Besitzer eines kleinen Segelboots am Bodensee, erzählen wilde Stories vom See und seinen ungemein tückischen Winden, die jedes Jahr einige Segler das Leben kosten. Wie beruhigend, daß wir bloß in den Roaring Forties und nicht auf dem Bodensee segeln! In zwei Tagen soll uns eine alte Zyklone von Westen her einholen, funkt Günther. Bis zur Ile aux Cochons, der westlichsten der Crozetgruppe, sind es noch 200 Seemeilen, vielleicht schaffen wir’s, dort Landschutz zu finden, ehe das Tief uns erreicht. Vorsichtshalber bleiben wir etwas nördlich unseres errechneten Kurses, um bei einem vorzeitig aufziehenden Sturm nicht zu weit nach Süden, an den Crozets vorbei, abgetrieben zu werden. Bei vier bis fünf Beaufort aus Nordnordwest segeln wir die ganze Nacht unter Blister, um so rasch wie möglich voranzukommen. Das Baro sinkt.
Der Crozet-Archipel besteht aus zwei Gruppen vulkanischer Eilande, die etwa 50 Meilen auseinander liegen: die westliche mit der Hauptinsel Ile aux Cochons (Schweineinsel), der kleinen Ile des Pinguins und einer Minigruppe, den zwölf Iles des Apôtres (Apostel); die östliche mit der Ile de la Possession und der Ile de l’Est. Die seit 1924 unter französischer Verwaltung stehenden Inseln sind unbewohnt, mit Ausnahme der Ile de la Possession, auf der sich eine französische Station befindet.
Wie die Prince-Edward-Inseln wurden auch die Crozets 1772 von Marion Dufresne entdeckt. Kapitän Cook, der diese nie selbst betrat, benannte die gesamte Gruppe später zu Ehren Crozets, der den Befehl über die französische Expedition übernommen hatte, nachdem Dufresnes von Maoris in Neuseeland erschlagen worden war, weil er ihre Rituale verletzt hatte. Welch eine seltsame Übereinstimmung, daß Cook, sieben Jahre nach Dufresnes Tod, auf Hawaii das gleiche Schicksal ereilte. Auch er hatte die Gebräuche der Eingeborenen mißachtet.
Auf der Fahrt bleibt uns Zeit, auch andere alte Aufzeichnungen zu studieren, von Schiffbrüchigen, Robben- und Walfängern, die durch diese Region kreuzten, als noch niemand sich vorstellen konnte, daß hier einmal Menschen zum Vergnügen herumsegeln würden. Am 28. November 1886 rammte der französische Schoner Tamaris versteckte Klippen südlich der Ile des Pinguins und sank. 13 Mann der Besatzung erreichten mit etwas Wasser und ein paar Kilo Schiffszwieback in einer kleinen Schaluppe nach zwei Tagen die benachbarte Schweineinsel. Dort hatten britische Robbenfänger einst Schweine ausgesetzt, sie später aber wieder ausgerottet, weil sich die Tiere hauptsächlich von toten Pinguinen ernährten und ungenießbar wurden. So blieben den Gestrandeten nur Vogeleier und Robbenfleisch zum Überleben. Verzweifelt ritzten sie im August des folgenden Jahres auf die Deckel alter Konservendosen einen Notruf und hängten sie Albatrossen um den Hals. 48 Tage später fanden Fischer in der Nähe von Perth (Australien) einen sterbenden Vogel am Strand und überbrachten dessen Luftpost den lokalen Behörden. Noch einmal vergingen zwei Monate, bis ein Rettungskommando von Madagaskar aus in See stach und tatsächlich die Schweineinsel erreichte. Doch die zwölftägige Suche verlief erfolglos; die Vermißten blieben für immer verschollen.
Auch wir steuern die Crozets mit gemischten Gefühlen an. Auf dem ganzen Archipel scheint es keinen wirklich geschützten Ankerplatz zu geben. Die Navigation ist schwierig, denn die Untiefen um die Inseln sind nicht genau vermessen.
Gegen Morgen zieht nasser, kalter Nebel auf. Bei der rasanten Fahrt durch die hohen Seen surrt und jault die Schwertsicherung so penetrant, daß Burkhard und Manfred in ihren Kojen an Backbord nur mit Walkmen auf den Ohren einschlafen können. Noch 130 Meilen bis zur Schweineinsel. Der Wind frischt auf, wir bergen den Blister. Nach Sonnenaufgang reißt der Nebel auf, am Horizont ein breiter Streifen Blau und blasses Sonnenlicht; gegen Mittag setzt sich die Sonne langsam durch. Luft fünf, Wasser vier Grad Celsius. Die Crew lebt auf, freut sich über den schönen, geruhsamen Tag. „Wir sind alle froh, wenn das Tief an uns vorbeigeht, und hoffen auf einen Sommertag auf Crozet“, schreibt Manfred voller Zuversicht ins Logbuch.
In der Nacht Rauschefahrt unter Blister. Steffen ist begeistert: „Nebel und intensives Meeresleuchten, phantastisch, gespenstisch! Jetzt kann ich verstehen, warum die alten Seefahrer oft abergläubisch waren und gern Seemansgarn gesponnen haben.“
Enorm hohe Luftfeuchtigkeit, bei der unsere Brillenträger am Ruder alle Mühe haben, den Kompaß zu entziffern. Um 10.00 Uhr haben wir die Schweineinsel zwei Seemeilen voraus im Radar. Bald darauf taucht sie dunkel und schemenhaft aus dem Nebel. Der Wind dreht auf Nordost, wir bergen den Blister. Kurz danach nur noch umlaufende Winde. Wir starten die Maschine, aber die Wasserkühlung streikt. Wieder ist das Saugrohr der Kühlwasserpumpe mit Kelp verstopft. Es folgen zweieinhalb Stunden Klempnerei im Eiltempo, während wir unter Segeln direkt auf die Steilküste im Nordwesten der Insel zulaufen. Als das Kelp entfernt ist, das Rohr wieder eingebaut und der Motor schließlich gestartet werden kann, droht die Felswand nur noch wenige Kabellängen entfernt.
Bei kaum 200 Meter Sicht hangeln wir uns dicht am Ufer entlang. Pinguine, Sturmvögel, Albatrosse und Seebären nehmen ein gemeinsames morgendliches Reinigungsbad und entsprechend wenig Notiz von uns. An langen schwarzen Stränden drängen sich Hunderte von Pinguinen, und an schroffen Hängen schimmern Vogelkolonien wie Flecken weißer Leuchtfarbe durch den Nebelregen. Man könnte sie aber auch ohne weiteres nur mit der Nase ausmachen.
Wegen des schlechten Wetters ist uns ein Landfall auf der Insel zu riskant. Wir entschließen uns, zu den acht Seemeilen entfernten Apostelinseln weiterzusegeln: bei kräftig auffrischenden vorlichen Winden und grober, entgegenlaufender Stromsee ein mühsamer Weg, trotz Maschinenunterstützung. Das Baro ist in den letzten zwei Stunden enorm gefallen, das angekündigte Sturmtief hat uns erreicht; wir brauchen dringend einen sicheren Ankerplatz. Doch wo? Die Navigation ist unzuverlässig, die Lage der Inseln nicht genau vermessen. Einzige Alternative: nach Osten ablaufen auf die offene See und dort beidrehen. Hält der Sturm jedoch mehrere Tage an, können wir das Anlaufen zumindest der westlichen Crozet-Inseln vergessen. Den abgedrifteten Weg wieder zurückkreuzen, würde zuviel Zeit kosten.
Außerdem ist nach 600 Seemeilen Wasser und Sturm unser Bedarf in dieser Richtung mehr als gedeckt, und wir sind froh und dankbar, am zweiten Meilenstein unserer Reise angekommen zu sein. Schon seit Tagen freuen wir uns auf diese Inseln, ganz besonders auf die Hauptinsel der Apostelgruppe, von der Gerry Clark begeistert schreibt, sie sei vielleicht die aufregendste und unglaublichste aller Inseln, die er je besucht hat. Er ankerte in einer geschützten Bucht und verbrachte dort eine angenehme und ruhige Nacht. Nichts wünschen wir uns sehnlicher!
Das Radar zeigt nur noch eine halbe Meile bis zum westlichsten Eiland der Zwölf Apostel. Kurze Zeit später treten bizarre dunkle Felsinseln aus dem Nebelschleier hervor – eine davon ist nur ein schmaler, hoher Turm. Allein der Anblick jagt uns schon kalte Schauer über den Rücken. Hier war 1875 das britische Schiff Strathmore gestrandet. 44 Überlebende schafften es, die Ile de la Possession zu erreichen, wo sie erst nach einem halben Jahr von einem amerikanischen Walfänger gerettet wurden.
Etwa eine Stunde lang suchen wir nach einem geschützten Liegeplatz. Irgendwo in Nordost muß die Bucht ja sein, die Gerry Clark beschreibt. Bloß wie sie finden?
Von den steilen Hängen herab fauchen uns Fallwinde von allen Seiten an und lassen uns die Nähe der Inseln spüren. Immer wieder taucht für Sekunden ein Labyrinth dunkler Felswände aus der Nebelsuppe auf, gegen die Seen mit grellweißen Gischtsäumen branden. Wie Geisterstimmen hallt uns das Heulen und Bellen der Seebären und das Trompeten der Königspinguine entgegen. Immer wieder kleine Einbuchtungen, steile Felsen links und rechts – wo sind wir bloß? Das Radar ist auf so kurze Distanzen keine Hilfe. Zu allem Überfluß zeigt das Echolot keine Tiefe mehr an, es ist defekt. Warum, um Himmels willen, bloß immer in solchen Situationen? Hastig basteln wir ein Provisorium, binden einen Ersatzgeber an den Piekhaken und halten ihn ins Wasser. Es funktioniert.
Aber das Echo warnt uns nicht vor den steil ansteigenden blinden Klippen; das tun auch nicht die an ihnen brandenden Seen, weil die Fallwinde das Wasser ohnehin ringsum zum Kochen bringen. Und dann passiert’s: Rums! Das Schiff wird durchgeschüttelt, legt sich im Schwell auf die Seite und muß harte Schläge einstecken, als es langsam über die Felsspitzen holpert. Lieber Gott, bloß kein Leck hier, bloß nicht stranden! Wohin sollten wir uns retten? Überall nur diese Wände … Rasch wird die Schwertsicherung gelöst, die Freydis kommt wieder frei. Allgemeines Aufatmen. Doch mit einem Ruck stoppt die Fahrt erneut. „Kurbeln!“ schreit Erich. Karl ist schon dabei. 30 Schläge, das genügt. Voraus ein tieferer Einschnitt. Vielleicht ein Schlupfwinkel? Nein, eine üble Winddüse. Also schnell wieder hinaus.
Bald darauf finden wir eine relativ ruhige Bucht, die uns aber viel zu klein ist. Kein winziges Fleckchen Strand, offenbar nur steile Felswände ohne Aufstiegsmöglichkeit, mit Höhlen voller Seebären. Sie fühlen sich in dieser martialischen Umgebung ebenso zu Hause wie die Pinguine. An dem langen, von den Felsen hängenden Tang lassen sie sich wie auf Rutschbahnen ins Wasser gleiten. Mit der hochschwappenden See gelangen sie wie im Fahrstuhl zurück in ihre Behausungen. Am Ufer gurgeln dunkle Höhlen, die auf uns wie Eingänge zur Unterwelt wirken. „Scheint eher ein Bärenzwinger als eine Bucht zu sein“, brummt Erich. Wir machen kehrt – und kommen später doch wieder zurück, denn einen besseren Ankerplatz auf Grande Ile finden wir nicht.
Als zusätzliche Sicherung zum Anker wollen wir wenigstens noch eine Leine an Land ausbringen. „Dort oben ist eine Art Poller, da können wir sie festmachen“, freut sich Erich, zur Felswand deutend. Aber der Poller wandert und gibt sich als Seebär zu erkennen. Steffen, Burkhard und Manfred gelingt es, die Insel vom Dingi aus über einen Felsvorsprung zu entern und die vorbereiteten, gespleißten Drahtseile zu befestigen; Tauwerk würde sich an den scharfen Felsen kaputt scheuern. An das Ende des 20-Meter-Drahtseils werden 100 Meter Leine geknüpft. Wie wichtig diese Vorsichtsmaßnahme ist, soll sich bald herausstellen.
Nach einer guten Stunde kehren die drei durchgefroren, aber dennoch in Hochstimmung an Bord zurück. Sie seien auf der Außenseite der Insel über Pinguin-Trampelpfade hochgestiegen, berichten sie, am Hang gäbe es eine große Kolonie Felsenhüpferpinguine, und weiter oben sei der Boden durchlöchert mit Bruthöhlen. „Vom Gipfel der Insel hatten wir eine wunderbare Aussicht: nach allen Seiten herrlicher Nebel!“ lacht Manfred, und Burkhard, der bei der Landung ins Wasser gefallen ist, beeilt sich, die nassen Klamotten abzustreifen und sich in der Koje wieder aufzuwärmen.
Morgen, wenn sich die Dünung gelegt hat, wollen wir alle gemeinsam an Land gehen.
Gemütliches Abendessen – Gemüseeintopf mit Burenwurst –, dann Lesen oder Tagebuchschreiben. Draußen ist es stockdunkel. Plötzlich fliegt etwas durch die Luft. Karl, der im ersten Moment dachte, jemand habe ihm – versehentlich natürlich – einen nassen Lappen ins Gesicht geworfen, will gerade protestieren. Doch zu seinen Füßen hockt ein Entensturmvogel, genauso verdattert wie er selbst. Noch mehrere vom Licht irritierte Vögel besuchen uns an diesem Abend, fliegen sogar ins Schiff hinein. Wir haben Mühe, sie alle wieder hinauszutragen, bevor sie sich irgendwo verstecken und Gefahr laufen, von uns eingesperrt oder getreten zu werden. Schließlich löschen wir das Licht.
Das Baro sinkt und sinkt, welche Teufelei hat das Wetter denn noch im Sinn? Schwere Fallböen orgeln von den Felsen auf uns herab, der Anker ruckt. Die Schreie der Vögel, das Bellen und Heulen der Seebären hallen durch die Nacht, und der Wind in der Takelage singt uns ein unheimliches Schlaflied.
Um 05.00 Uhr habe ich Ankerwache. Peitschende Sturmböen werfen die Freydis kreuz und quer, soweit Leine und Anker es erlauben. Gischtteufel tanzen durch die Bucht. Der Nebel hat sich verflüchtigt. Draußen ist die Hölle los, überall Schaumkämme, waagerecht fliegendes Wasser. Es tost, donnert und kracht. Über die Eingangsfelsen spritzt die Brandung viele Meter hoch. Die Bucht ist ein ungemütliches Nest geworden. Im Cockpit ist es naß und kalt. Als gäbe es für sie keinen Sturm, jumpen Pinguine und Robben durch die aufgewühlte See. Zwei Stunden später Frontdurchzug, steiler Baro-Anstieg. Typisches Rückseitenwetter zieht auf: blauer Himmel und Sonnenschein. Gegen Mittag ist der Spuk vorbei. Auf zur Insel. „Bloß keine Zeit verlieren!“ treibt uns Erich zur Eile an.
Die See bricht sich immer noch mit hohen weißen Gischtsäumen ringsum an den Felsen. Nur dort, wo wir gestern die Drahtschlinge angebracht haben, ist es auch heute wieder relativ ruhig. Der Aufstieg könnte klappen, meinen die Experten, während Erhard, Karl und ich lieber auf der Freydis bleiben wollen. Zwar käme ich gern gleich mit auf die Insel, aber die Brandung ist mir noch zu hoch, das Anlanden zu riskant. Erich verspricht, mich in ein paar Stunden zu holen, wenn die See sich beruhigt hat.
Erich, Manfred, Burkhard, Peter, Steffen und Erhard, der das Dingi wieder zurückbringen soll, setzen in zwei Schüben zur Insel über. Sie spannen eine dünne Leine vom Schiff zum Land, an der sich Erhard auf dem Rückweg gut entlanghangeln kann; außerdem besteht auf diese Weise keine Gefahr, bei ablandigem Wind aufs offene Meer hinaus getrieben zu werden. Bei dem hohen Schwell gelingt das Landemanöver nur knapp. Erich läßt mir von Erhard ausrichten, daß ich heute besser an Bord bleiben sollte.
Was die Mannschaft auf der Insel erlebt, beschreibt Burkhard in seinem Tagebuch: „Ich versuche, vom Dingi aus an Land zu springen, finde jedoch keinen Halt am glitschigen Fels. Keine leichte Sache bei dieser Brandung. Manfred will aufgeben, zu gefährlich, meint er. Aber ich versuch’s noch einmal, und es klappt. Freudenschreie auf der Freydis und in mir selbst. An einem Felsen befestige ich ein Seil, um den anderen das Klettern zu erleichtern. Zu fünft stiefeln wir los, besteigen den höchsten Punkt in stundenlangem kräftezehrendem Marsch über das oberste Stockwerk der Insel. Auf den grünen Matten brüten im Windschatten die Wanderalbatrosse und Felshüpfer-Pinguine: ein Vogeldorado, in dem wir viel Zeit verbringen, um die Tiere zu beobachten und zu fotografieren. Wir finden sogar Schwarzbrauen- und die von Erich gesuchten, seltenen Gelbnasen-Albatrosse.
Oben herrscht ein tierischer Wind, der immer schlimmer wird. Auf dem Bauch liegend, robbe ich an eine senkrechte Felskante heran und blicke in die Düse zur Nachbarinsel mit ihren Riffen und Felsen. Hier haben wir gestern im Nebel eine Ankerbucht gesucht – unglaublich! Als ich wieder oben bin, geht’s auf den Rückweg. Erich und Steffen sind schon vorausgelaufen. Plötzlich erfaßt mich eine Bö und wirbelt mich durch die Luft. Ich habe keine Gewalt mehr über mich – ein saudummes Gefühl. Der Orkan schmeißt mich schließlich auf den Boden. Mein linkes Knie schmerzt, und ich habe überall Schürfwunden. Wegen der Kälte spüre ich allerdings wenig. Manfred und Peter kommen zu mir gekrochen, um mir zu helfen. Aber bei dem fürchterlichen Wind – Erich spricht später von 14 Windstärken – hat jeder für sich selbst zu kämpfen. Auf allen Vieren, ständig an Felsen festgeklammert, kriechen wir den Hang hinunter.“
Unsere Hoffnung, die See würde sich beruhigen, erfüllt sich nicht. Obwohl die Sonne von einem wolkenlos blauen Himmel scheint, der Wind – soweit wir das in der Bucht beurteilen können – abnimmt und das Baro steigt, wird sie immer wilder. Zu meinem Entsetzen haben die Seen ihre Richtung gewechselt, so daß die Brecher jetzt direkt in unsere kleine Bucht branden. Weiß vor Gischt, liegt sie wie im Nebel. Dann die erste Wasserwand … Eine etwa acht Meter hohe, schäumende Woge rast auf uns zu, überspült den gesamten Felseingang der Bucht und einen Großteil der Höhlen. Etwa jede fünfzigste See ist so ein Kaventsmann. Es sind hohe Dünungswellen, die sich auf dem flacheren Ufer zu Grundseen aufsteilen, brechen und eine mörderische Brandung erzeugen. Daß sie nicht über unserem Schiff zusammenschlagen, verdanken wir allein dem breiten, dämpfenden Kelpgürtel, hinter dem wir liegen.
Die Seebären haben sich auf die höchstgelegenen Felsen verkrochen und raufen sich brüllend um die sichersten Plätze. Pinguine werden in Scharen von den Simsen gewaschen, ohne jede Chance, wieder aufsteigen zu können. Nur wenigen gelingt es, sich weiter oben an die Felswände zu krallen. Sie tun mir leid, aber uns geht es noch schlechter, viel, viel schlechter. Wir bangen um unser Leben. Die Festmachertrosse erweist sich als Segen, sie läuft nicht direkt, sondern in einer Kurve um das Kelpfeld herum und wirkt dadurch wie eine Feder. Aber das Schleifen der Kette, das Rucken des Ankers läßt uns schaudern. Sollte er sich losreißen, zerschellen wir bestimmt an der Felswand. Wir müssen unbedingt einen zweiten Anker ausbringen!
Unter Erichs Koje krame ich eilig zwei Überlebensanzüge für Karl und Erhard heraus, ich selbst ziehe meinen Naßbiber an. Das letzte Mal habe ich ihn bei der Strandung auf Deception getragen. Damals bin ich davongekommen, das Schicksal war mir gnädig. „Einmal ist genug“, heißt es. Habe ich nichts daraus gelernt? Ist das jetzt die Strafe?
Gemeinsam zerren wir die 30 Meter Reservekette aus der Bilge, schäkeln sie an den zweiten Bügelanker und werfen, nachdem wir die Kette am Poller befestigt haben, vom Cockpit aus Anker samt Kette über Bord. Danach ist uns ein wenig wohler. Aber unsere Situation bleibt unverändert kritisch.
Was für eine atemberaubende Szenerie! Ginge es nicht ums Überleben, könnte man sie staunend genießen oder filmisch und fotografisch dokumentieren. So aber mag ich kaum hinschauen. Bei Todesangst ist Dokumentation kein Thema mehr.
Die Bucht ist zu einem schäumenden Hexenkessel geworden. Die Freydis tanzt auf und ab, wird hochgerissen und zurückgeworfen, hin und her geschleudert wie in einem überdimensionalen Shaker. Das ganze Schiff scheint in Aufruhr, alles poltert durcheinander: Dosen und Flaschen in den Schapps, Geschirr in den Schränken, Decken, Kissen, Klamotten, Walkmen, Bücher aus den Kojen. Türen öffnen sich, schlagen hysterisch auf und zu, die schwere Klappe zum Motorraum landet krachend im Gang – ein Tohuwabohu. Lohnt es noch, hier aufzuräumen, während Schlimmeres droht? Ich räume trotzdem auf, mechanisch wie ein Roboter. Was sonst? Warten auf das Ende. Auf welches? Das Gefühl der Ohnmacht ist am schlimmsten.
Wie zum Hohn steigt das Baro weiter; trotzdem haben wir Orkan. Die Stunden vergehen, und nichts wird besser, im Gegenteil: Immer häufiger öffnen sich gähnende Täler vor uns. Das Wasser weicht zurück, als ob die ganze Bucht leergesaugt werden sollte. Fassungslos blicken wir in Abgründe und glauben, jeden Moment mit dem Schiff auf Grund zu hauen, aber da kommen schon die nächsten Wasserwände angerollt, senkrecht wie kleine Tsunamis. Alles mitreißend, peitschen sie durch die Bucht, brechen sich bei nun ablaufendem Wasser auch an einem Unterwasserfelsen ganz in unserer Nähe, den wir bisher noch gar nicht bemerkt haben. Wenn das Kelpfeld vor uns nicht wäre, das ihnen die Spitze ihrer zerstörerischen Kraft nimmt, wären wir verloren. Es wirkt wie Waltran, den die Seeleute früher über Bord kippten, um im Sturm die Wellen zu besänftigen.
Wir zwingen uns zur Ruhe. Am liebsten würden wir die beiden Ankerketten und die Festmacherleine loswerfen und mit voller Maschinenkraft auslaufen. Doch bei der geringsten Komplikation mit der Maschine würden wir von den Brechern an den Felsen zermalmt werden. Wenn wir mit unserer 60-PS-Maschine tatsächlich rauskämen, müßten wir die anderen Crewmitglieder auf der Insel ohne Nahrung und ohne ausreichende Kleidung zurücklassen. Und wer weiß, wann wir zurückkehren könnten, falls uns der Sturm vertriebe? Auch hätten wir keine Anker mehr, um in einer anderen Bucht Sicherheit zu finden. Also abwarten.
Trotzdem beherrscht uns weiterhin quälender Zwiespalt: auslaufen oder nicht? Wenn Erich doch bloß hier wäre! Aber er weiß ja nicht einmal, was in der Bucht los ist. Der Gedanke, ihn vielleicht nie mehr wiederzusehen, ihm nichts mehr sagen zu können, bereitet mir Schmerzen. Damals bei unserer Strandung waren wir wenigstens zusammen. Ihn oben am Felsrand zu sehen, wäre mir schon ein Trost. Aufs Schiff kann er nicht zurück, niemand kann jetzt auf- oder absteigen, nicht einmal die Pinguine.
Nicht nur mein Herz rast, wenn die Roller kommen, die Ketten sich spannen, es unter uns ruckt und rumpelt. Auch Karl und Erhard haben Angst. Jedesmal denken wir, jetzt reißt es die Anker heraus. Karl ist still und ungewohnt ernst, Erhard eher ruhelos. Angeleint robbt er aufs Vordeck, schaut nach Leinen und Ankerketten und ist überhaupt unermüdlich in seiner Sorge ums Schiff. Wir müssen den Motor startklar machen, vielleicht ist er bald unsere einzige Chance. Aber das viele Kelp um uns herum! Es wird – wie schon so oft – den Impeller verstopfen, und was dann? Wo bleiben nur die Fünf auf der Insel? Die Sonne steht schon tief, warum kommen sie nicht? Ist ihnen etwas passiert?
Plötzlich steht Manfred oben am Fels. „Da kommen sie“, ruft Erhard. „Da sind auch Erich und die anderen. Endlich!“ Auch wenn sie an unserer Not nichts ändern können, empfinden wir ihre Anwesenheit doch als große Erleichterung, als nähmen sie uns etwas ab von unserer Angst. Ich freue mich, Erich zu sehen, fühle mich gleichzeitig aber gerade jetzt entsetzlich allein und im Stich gelassen. Hatte ich nicht davor gewarnt, an Land zu gehen? Jetzt haben wir den Schlamassel! Wären wir alle an Bord geblieben, hätten wir bei den ersten Brechern aus der Bucht laufen, draußen auf offener See beidrehen und abwarten können. So aber haben wir hier gewartet und ausgeharrt, bis es zum Auslaufen zu spät war und vielleicht für alles andere auch.
Dieses verdammte Fotografieren! „Nein, ich will nicht, daß du fotografierst! Nicht jetzt, nicht hier. Scheißfotos!“ schreie ich nach oben, obwohl mir eher zum Weinen zumute ist. Aber Erich hat gar keinen Fotoapparat mehr in der Hand. Er schaut nach der Festmacherleine, macht Zeichen und brüllt, wir sollen den Motor laufen lassen, zehn Minuten, damit er nicht streikt, wenn wir ihn brauchen. Also Entlüften, Ventil öffnen, Keilriemen zurechtklopfen, starten. Aus dem Auspuff sprudelt das Wasser, wie es soll. Unser letzter Ausweg schnurrt beruhigend. Nach zehn Minuten stellen wir die Maschine wieder ab. Wie gut, etwas tun zu können. Erich scheint sich zu freuen. Er hält die Faust hoch, schüttelt sie: Viel Glück und bloß nicht unterkriegen lassen, heißt das.
Aber es geht ihm nicht gut dabei. „Als wir nach sechsstündiger, anstrengender Wanderung durch die großartige Natur auf der Grande Ile der Apostelgruppe zu unserer Ankerbucht zurückkehren, bin ich auf den grauenhaften Anblick, der sich uns bietet, nicht vorbereitet“, schreibt er später ins Logbuch. „Das Bild der tanzenden Freydis, die sich bei jedem Brecher fünf bis zehn Meter hebt und dabei auf die Steilküste zurast, ist furchteinflößend. Ich bin in tiefer Sorge um Heide, Erhard und Karl. Sie müssen die Bucht fluchtartig verlassen, denke ich spontan. Wenn Anker und Festmacherleine slippen und ein Brecher sie trifft, sind sie verloren. Die drei hätten nur das Schlauchboot, aber keine Möglichkeit, an Land zu kommen. Als erstes überprüfe ich die Leinenverbindung. Wir verändern die Lage des 20-Meter-Drahtstanders an seinem Ende, damit die Leine nicht an den Felsen durchscheuert. Dann suchen wir noch einmal die ganze Bucht ab, ob es nicht doch einen Flecken, vielleicht eine Höhle gibt, wo sie mit dem Dingi anlanden könnten; dann würden wir sie mit unseren Leinen von oben abbergen. Aber vergebens.“
Die Sonne ist untergegangen, dunkle Wolken sind am Himmel aufgezogen. Unsere Leute haben eine eiskalte, windige Nacht im Freien vor sich. Trotzdem wären wir tausendmal lieber bei ihnen als hier an Bord. Vor Einbruch der Dunkelheit schaut Erhard noch einmal aufs Vorschiff und kürzt die Festmacherleine, die aus der Klüse gesprungen ist und an der Lochleiste schamfilt. Außerdem schneiden wir die dünne Dingi-Sorgleine zum Land durch, die sich nun völlig verheddert kreuz und quer unterm Schiff durchzieht. Wir müssen verhindern, daß sie uns bei einem Auslaufmanöver in den Propeller gerät.
Riesensturmvögel schwimmen am Kelprand, zerfleischen verwundete Pinguine und Robbenbabies, die von den Brechern gegen die Felsen geschlagen wurden. Vielleicht hacken sie irgendwann genauso auf uns herum?
Aus Erhards Notizbuch: „Diese Nacht werden wir um unser Überleben besorgt sein. Solange es hell ist, kann ich mich durch Arbeit ablenken, bei Dunkelheit bleibt nur noch das Warten. Gut, daß Heide und Karl normal reagieren. Es gibt Runden, wo ich mich nur dank autogenen Trainings ruhig halten kann. Ich bin sicher, daß meine Chance zu überleben sehr gering ist. Negative und positive Ereignisse aus meinem Leben gehen mir durch den Kopf. Ich bin traurig darüber, daß meine Freundin bei meinem eventuellen Tod leiden muß. Aber nun bin ich soweit, daß ich mir sage, was passiert, das passiert. Auch wenn ich in der Brandung treibe, ich werde nicht aufgeben!“
Karl: „Die vielen Stunden mit dem Tod vor Augen sind schrecklich. Ich habe ja gewußt, daß dieser Indiktörn keine normale Segelreise wird. In Büchern habe ich von 150 Kilometer Windgeschwindigkeit, von Monsterwellen und von kochender See gelesen. Aber wer kann sich so etwas schon vorstellen, wenn er es nicht am eigenen Leib erfahren hat? Den Überlebensanzug wollte ich gar nicht anziehen – wenn es soweit ist, sollte es lieber schnell gehen –, aber dann habe ich daran gedacht, daß ich meiner Frau versprochen habe, wiederzukommen.“
Die Nacht bricht herein, rabenschwarz. Die satanische Geräuschkulisse der Bucht terrorisiert uns jetzt noch lauter. Das Heranrauschen und Branden der Seen, das Heulen und Brüllen der Seebären in ihren Höhlen, das Rucken, Scharren und Rumpeln der Anker unter uns ist kaum noch zu ertragen. Ab und zu leuchten wir mit dem Halogenscheinwerfer das Inferno ab, um unsere Position zu überprüfen. Aber in der Nacht sind Entfernungen schlecht einzuschätzen. Die Wand scheint näher zu rücken und mit ihr die grellweißen Brandungstreifen und Gischtfontänen. Irgendwann entdecken wir, daß der Ankerball vertrieben ist. Ein böses Omen: Auf Deception, vor drei Jahren, war das der Auftakt zur Strandung. Slippt der Anker, ist er gebrochen? Bei Dunkelheit schwer zu beurteilen. Wenn der andere Anker ebenfalls slippt oder bricht, dann gute Nacht!
Ich überwinde meine Schreckensstarre, bereite Kakao, hole Kekse und Schokolade. Wir brauchen unsere Kräfte dringend; zwar haben wir alle keinen Appetit, aber einen leeren Magen. Auf den Keksen kauen wir herum wie auf Schuhsohlen. Mir ist speiübel. Immer häufiger leuchten wir jetzt unsere Umgebung ab, können jedoch zum Glück keine weitere Änderung unserer Position erkennen.
Warum nehmen bloß die Wellen nicht ab? Wir haben doch fast keinen Wind mehr, allenfalls ist er umlaufend. Ich kann mir diese verrückte See nur damit erklären, daß weiter draußen ein schrecklicher Sturm wütet und wir den Schwell abkriegen.
Manchmal sehen wir unsere Leute oben auf den Klippen, wie sie versuchen, sich durch Bewegung warm zu halten. Sie sind verschwitzt von ihrem Ausflug zurückgekommen und jetzt völlig unterkühlt. „Wir versuchten, in wärmender Löffelstellung im Schutz eines Steilhangs zu schlafen“, erinnert sich Erich später an die Nacht. „Aber die Kälte und die Angst, daß sich die Freydis losreißen könnte, mit allen entsetzlichen Folgen, ließ mich nicht zur Ruhe kommen. Um uns herum Hunderte von Pinguinen mit ihren Jungen. Daß wir im Pinguinkot lagen, störte mich nicht. Aber kaum hatten wir uns hingelegt, kamen die Scheidenschnäbler, diese kleinen weißen Leichenfledderer, um an uns herumzupicken.“
Morgengrauen, und noch immer Weltuntergangsstimmung! Aber kein Zweifel: Die Roller werden niedriger, kommen in größeren Abständen und verlieren an Kraft. Zwischen den hohen Wasserwänden gibt es immer wieder Serien flacherer Wellen. Das ist eine Besserung unserer Lage, die uns neues Leben einhaucht, uns endlich wieder Mut fassen läßt.
Erhard sieht eine Chance, unsere Landgänger zu bergen. Wir befestigen am Dingi eine dünne Leine, die Erhard hinter sich herziehen will. Falls etwas schiefgeht, werden Karl und ich die Leine, so rasch wir können, einholen und daran das Dingi mit Erhard zur Freydis zurückziehen. Wir binden auch die Paddel im Boot fest, damit sie nicht herausgewaschen werden können. Ich bewundere Erhards Mut: Er rudert zunächst am Kelprand entlang und dann vorsichtig, ständig nach Brechern Ausschau haltend, über das freie, noch immer von mörderischen Seen bedrohte Wasserstück in Richtung auf den Abstiegsfelsen.
Auch die Landgänger sind startklar. Nach zwei bis drei extrem hohen Brechern herrscht immer etwas Ruhe in der Bucht, das müssen wir ausnutzen. Das Boot tanzt unter den Felsen auf und nieder. Die einzige Chance, an Bord zu kommen, ist ein gewagter Sprung, wenn das Dingi auf einer Welle emporschwappt. Burkhard und Manfred wollen zuerst springen – und werden prompt vom Fels gewaschen. Manfred kann sich noch nach oben hangeln, Burkhard hängt in der Steilwand am Seil. Zweiter Anlauf zu einem haarsträubenden Manöver: Erhard manövriert das Dingi unter Burkhard, der sich hineinfallen läßt.
Die Bergung der übrigen vier verläuft ohne Komplikationen. Steffen: „Ich wundere mich, daß keiner von uns in Panik geraten ist. Ich hatte schreckliche Angst, aber ich bin gesprungen.“
Als alle heil an Bord sind, fließen Tränen. Fluchtartig verlassen wir die Bucht.

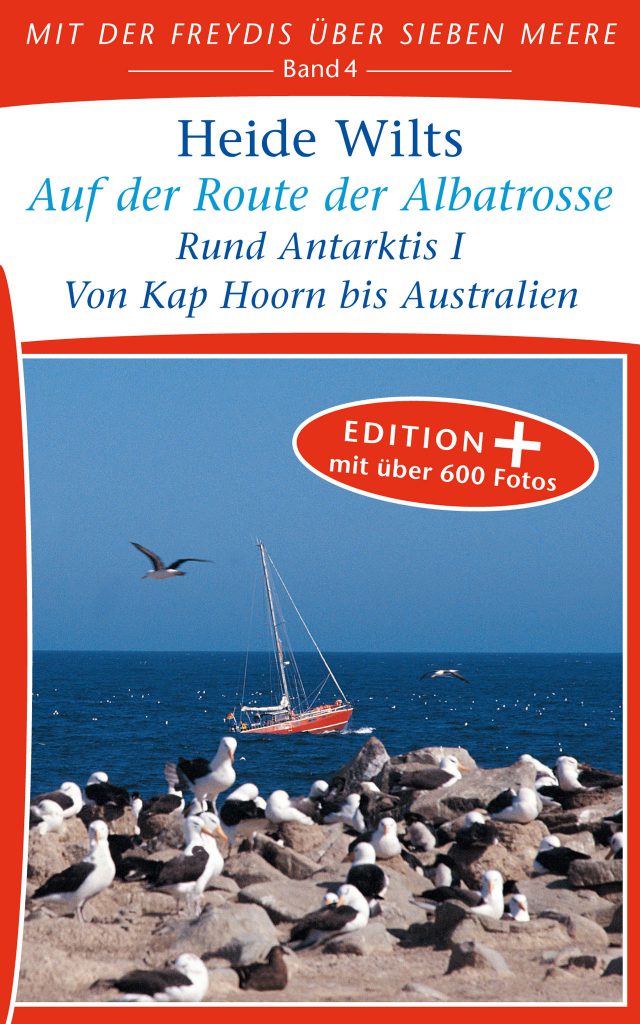








 Blauwasser.de – Judith und Sönke Roever
Blauwasser.de – Judith und Sönke Roever Literaturboot.de – Detlef Jens
Literaturboot.de – Detlef Jens