Zur Buchvorstellung // Zur Buchserie
Leseprobe aus Kapitel 7 „Midway-Atoll“:
Abschied von Kauai
Ein Highlight unserer Reise nach Japan wird das entlegene Midway-Atoll sein, das die Freydis bereits auf ihrer ersten Alaska-Reise angelaufen hat. Dieses Riff mit seinen drei Sand- und Korallenkrümeln auf halbem Weg zwischen Kalifornien und Japan ist ein einzigartiges Kleinod der Natur: Dort brüten von Dezember bis Juni rund zwei Millionen Seevögel – davon mehr als eine Million Laysan- und Schwarzfuß-Albatrosse!Die 1200-Meilen-Etappe von der Hawaii-Insel Kauai zum Midway-Atoll ist eine Nonstop-Passage: Alle Inseln und Riffe der Kette dazwischen sind streng geschützt und dürfen ausschließlich von autorisierten Personen betreten werden. Um Midway zu erreichen, müssen wir voraussichtlich aus dem Passatgürtel in die angrenzende Zone wechselnder Winde, die „Rossbreiten“, segeln. Vor vier Jahren war das harmlos auf dieser Strecke – mit Stürmen bekamen wir es erst vor den Aleuten zu tun. Aber damals sind wir auch erst Ende Mai gestartet, zu Beginn des Sommers, unser Ziel hieß Alaska. Nun heißt es Japan, und wir müssen Anfang Februar auslaufen.
Seit dreißig Jahren segeln Erich und ich immer wieder große Ozeanpassagen zu zweit. Auch wenn sich diese Langfahrten manchmal als schwieriger erwiesen als ursprünglich angenommen, so blieben sie uns doch überwiegend als besonders schön in Erinnerung. Deshalb waren wir uns diesmal schnell einig, dass wir die 4000 Seemeilen von den Hawaii-Inseln über das Midway-Atoll nach Japan – von der Distanz mehr als eine Atlantiküberquerung – zu zweit angehen wollten.
Die wenigen Tage im Hafen von Nawiliwili auf Kauai, unserem letzten Zwischenstopp vor Midway, nutzen Erich und ich zur Vorbereitung auf die lange Weiterreise. Wir bauen einen neuen Motor für die Selbststeueranlage ein, wechseln Lenzpumpen aus, übernehmen Diesel und Wasser und kaufen Proviant für die nächsten Monate.
Vorsorglich legen wir auch unsere neueste Errungenschaft aus den USA auf dem Achterschiff bereit, einen fertig montierten „Jordan Drogue“. Dieser neu entwickelte Treibanker – viele kleine Bremsfallschirme hintereinander an langem Tau –, vor dem man vor Top und Takel abläuft, soll verhindern, dass das Boot im Sturm oder Orkan in hohen überbrechenden Seen querschlägt oder über Kopf geht.
Ausnahmsweise übernimmt die Coastguard die Formalitäten für die Ausklarierung nach Chichi-jima, Japan, denn der einzige Zollbeamte der Insel ist inzwischen pensioniert. Die Beamten wünschen uns viel Glück. Auf See winken uns Buckelwale mit ihren langen Flossen zu und auf geht’s bei Sonnenschein und leichten südlichen Winden gen Westen.
Vielleicht hätten wir Midway gestrichen und den Kurs über den Passatgürtel nach Japan gewählt, wenn wir geahnt hätten, was uns das Wetter auf den nächsten 2000 Meilen beschert: von wegen „leichte Winde“ in den Rossbreiten! Bereits nach 12 Stunden, um Mitternacht, dreht der schöne Ostwind über Südwest auf West und legt im Laufe des Tages auf 7-8 Windstärken zu. Längst haben wir unter doppelt gerefftem Großsegel beigedreht und driften mit zwei Knoten nach Süden, weg von den Inseln und Riffen, an denen wir uns doch ganz gemütlich hatten entlanghangeln wollen.
Tatsächlich ist das Rossbreiten-Hoch weit nach Süden in Richtung Äquator gewandert und an seiner Nordflanke blasen uns starke westliche Winde entgegen. Dazu überrascht uns alle paar Tage ein neues Tief mit Winddrehungen über Süd auf Südwest, Frontdurchgang und für einige Tage Schwerwetter. Zwar dreht der Wind anschließend wieder langsam auf Nord, bringt Wetterbesserung und ein paar Stunden herrlichen Ostwind. Doch schon rauscht das nächste Tief an, und das Spiel beginnt von vorn.
Giftgas mit Starkwind
Wir haben keine Wahl mehr. Mühsam kämpfen wir uns gegen die vorherrschenden Winde nach Westen, versuchen jede kleinste Winddrehung zu nutzen, werden gebeutelt und gestoßen von einer rauen, durch die Meeresströmungen chaotischen See. Segeln zum Abgewöhnen! So geht das Tag für Tag.Umso glatter läuft alles an Bord. Erich und ich verstehen uns ohne viele Worte. Wir sind aufeinander eingespielt, arbeiten Hand in Hand und sichern uns gegenseitig bei den Manövern. Einziger Haken: Wir leiden beide unter Seekrankheit. Um den Magen zu beruhigen, schlucken wir gelegentlich Vomex-Dragees. Außerdem habe ich mir zur Sicherheit auch ein Scopodern-Pflaster hinters Ohr geklebt. Wenn einer von uns zu müde, seekrank oder sonst irgendwie unpässlich ist, übernimmt automatisch der andere die Wache – unsere Wachzeiten sind flexibel. Beim Reffen ist unsere Devise „besser zu früh als zu spät“. Dann kommt nie zu viel Druck auf die Segel und die Gefahr von Unfällen oder Materialschäden wird minimiert.
Auf halbem Wege nach Midway bemerken wir Abgase im Schiff. Erich kontrolliert das Auspuffsystem im Maschinenraum und stellt fest, dass eine Schweißnaht am Flansch der Hauptmaschine eingerissen ist. Die Hauptmaschine aber brauchen wir jeden Tag ein bis zwei Stunden zum Laden der Batterien: Die beiden starken Verbraucher – die Tiefkühlbox und vor allem die Selbststeueranlage – wollen versorgt sein, denn der Dieselgenerator hat schon in Mexiko seinen Geist aufgegeben und der mobile Honda Benzingenerator kann bei dem rauen Wetter und der ständig überkommenden See nicht an Deck aufgestellt werden.
Sobald die Hauptmaschine läuft, müssen wir an die frische Luft, sonst ziehen wir uns eine Kohlenmonoxid-Vergiftung zu. Kopfschmerzen und Übelkeit bleiben trotzdem nicht aus. Was machen wir nur, wenn das Auspuffrohr ganz bricht und abreißt? Nur unter Segeln, ohne Maschine, können wir uns kaum in die schmale, strömungsreiche Passage wagen, die zum kleinen Hafen des Midway-Atolls führt. Sie ist nicht ungefährlich, das wissen wir von unserem letzten Besuch, und sie hat schon etliche Schiffe auf dem Gewissen.
Zwei Tage später Entsetzen: Das Auspuffrohr ist abgebrochen. Erich fixiert es notdürftig mit Draht und kräftigen Expander-Gummis am Flansch. Doch das ändert nichts an der Tatsache: Die Maschine darf nur noch im Notfall eingesetzt werden. Das Rohr muss geschweißt werden.
Sollen wir zurücksegeln? Aber Kauai liegt nun ebenso weit entfernt im Osten wie Midway im Westen – 600 Meilen! Und wer weiß, ob der Wind nicht bald dreht. In der Hoffnung, dass es an unserem Ziel eine Werkstatt und einen Schweißer gibt, beschließen wir weiterzulaufen.
Der Wind dreht am Mittag des folgenden Tages, es ist der 6. Februar, auf SSW: „Wir laufen wie geschmiert, 6-7, manchmal sogar 8 Knoten!“, freut sich Erich, nachdem wir die Segel ausgerefft und gefiert haben. Endlich gut vorankommen, endlich frische Luft durch geöffnete Luken, endlich Ruhe im Schiff! Balsam für die strapazierten Nerven.
Warum sich Sorgen machen? Niemand ist über Bord gegangen. Und das Rohr, das kriegen wir schon wieder hin! Wir fassen gerade wieder Mut, als Erich bei der Kontrolle der Bilgepumpe einen Bruch am Verteiler unter der Niedergang-Treppe feststellt. „Jemand muss da drauf gestanden haben“, brummt er. Und das bedeutet wieder ein paar Stunden Arbeit im schwankenden Boot für ihn, um ein Provisorium anzufertigen.
Als wir am Maro Reef vorbei sind, können wir Midway sogar vorübergehend anliegen. In der Luft sehen wir immer mehr Laysan- und Schwarzfuß-Albatrosse: Sie haben ihre Nistplätze auf den Inseln und sind auf der Suche nach Futter für ihre Jungen. Doch im Meer schwimmt nicht nur Fisch, sondern auch eine Menge Plastik: Während meiner Wache entdecke ich eine abgebrochene Stuhllehne, eine Flasche, einen 5-Liter-Kanister, mehrere Plastiktüten und einen Styropor-Kasten. Und das ist nur Makromüll. Klein- und Kleinstteile landen leider oft in den Mägen der Vögel.
Erich klagt zunehmend über Kopfdruck, mir ist sowieso kotzübel. Natürlich machen wir uns Gedanken, wie wir auf Midway empfangen werden. Die Naturschutz-Bestimmungen sollen strenger geworden sein. Das ist zwar ganz in unserem Sinne, aber wir wissen auch, dass diese Bestimmungen recht unterschiedlich ausgelegt werden. Sind Segelboote überhaupt willkommen?
Außerdem haben wir bereits aus den USA ausklariert, dürfen offiziell also gar nicht mehr anlanden. Wir hoffen trotzdem, dass wir auf diesem entlegenen Eiland, fern der Bürokratie, Verständnis finden für unsere Situation.
Am 8. und 9. Februar liegen wir wieder einmal beigedreht, nun aber am Nordrand eines sich ausdehnenden Hochs. Daraus weht es mit 40 bis 50 Knoten in ein Orkantief, das dicht nördlich an uns vorbeizieht. Günther aus dem Taunus, unser Wetterfrosch, mit dem wir fast täglich über Iridium-Handy in Verbindung stehen, spricht uns Mut zu. Der Sturm wird in den nächsten 24 Stunden abnehmen, der Wind aber nicht drehen, sondern weiter aus West blasen. Keine Aussicht auf eine grundlegende Änderung. Also beißen wir die Zähne zusammen und quälen uns tagelang weiter gegenan. Besonders unangenehm ist die See, wenn der Wind gegen den Strom steht. Das Schlimmste aber sind die langen, dunklen Nächte bei Neumond. Dann ist die Bolzerei besonders unerträglich, weil man die Brecher nicht sieht, die aufs Boot eindreschen. Man kann sich nicht auf die Schläge einstellen. Wir überlegen, ob wir schon einmal so eine schreckliche Fahrt hatten. Wir können uns auch an einige Strecken erinnern, aber sie waren nie so lang …
Der Wind lässt nur langsam nach. Endlich, am zwölften Tag, bringt uns der letzte Kreuzschlag in Lee des Midway-Atolls bis dicht ans Riff. Wir drehen bei, kontrollieren Abstand und Drift mit dem Radar und warten auf den Morgen. Der Wind weht nur noch mit drei bis vier Windstärken aus Westen. Nach dem Getöse der vergangenen Tage genießen wir diese Ruhe umso mehr.
Um 08.30 Uhr geht die Sonne auf. Rosa Morgenlicht und der Himmel voller Vögel. Was für ein traumhafter Anblick!
Schneewittchen-Gefühle
Midway ist ein Atoll von rund fünf Meilen Durchmesser. Die Vulkaninsel selbst ist längst untergegangen. Nicht aber das umgebende Korallenriff, das weiter gewachsen ist und auf dem sich mit der Zeit drei Riffinseln aus Korallenschutt und Sand aufgebaut haben. Die größte ist Sand Island.Wir melden uns über UKW auf der Station, schildern unsere Situation und starten die Maschine. Eine Stunde später liegen wir im kleinen Innenhafen von Sand Island an der Pier, wo uns Math, der Stationsleiter, und Toby, der 1. Ingenieur, schon erwarten: „Stinkt alles nach Abgasen. Mir wird schon übel, wenn ich da nur reinschaue!“, rümpft Toby die Nase, als er den Schaden begutachtet, und ist erst einmal schnell wieder von Bord.
Die Insel entschädigt uns mit ihren einmaligen Naturwundern für alle Mühsal: Hier sind gerade über 420 000 Paare von Laysan- und 24 000 Paare von Schwarzfuß-Albatrossen am Balzen, Brüten oder mit der Aufzucht ihrer Jungen beschäftigt. Wenn man die Jungvögel mitzählt, sind es sogar weit über eine Millionen Albatrosse!
Ich kann kaum beschreiben, wie glücklich ich hier bin. Nicht nur, weil der Auspuff repariert wird, sondern weil ich mich, inmitten all der tapsenden, tanzenden, trompetenden, schnabelklappernden Albatrosse fühle wie im Märchen – wie Schneewittchen bei den, nicht sieben, sondern 1,5 Millionen Zwergen!
Die gefiederten Wichte, die kaum Scheu vor mir zeigen, sind überall, sitzen oder wandern auf allen Straßen, Wegen, Wiesen, Waldflächen und Stränden, spazieren durch alle Gärten und offenen Türen. Sogar die Freydis haben einige schon besucht.
Mit dem gasbetriebenen Cart, das uns der Stationsleiter Math zur Verfügung gestellt hat, können wir nur Slalom fahren und müssen immer wieder anhalten, wenn sich Gruppen junger Erwachsener auf offener Straße zanken und Schnabelgefechte liefern oder wenn sie in Tanz- Ekstase die Welt um sich herum vergessen. Aber was macht das schon, wenn die einzigen Termine die Mahlzeiten im „Clipper House“ sind? Dass wir’s trotzdem eilig haben, liegt allein an Mr. Pongs Kochkünsten. Und was für eine köstliche Torte er für mich gebacken hat an meinem Geburtstag!
Küchenchef Pong gehört zu den etwa 50 Thailändern, die für mindestens ein Jahr unter Vertrag stehen. Sie arbeiten in der Werkstatt, im Restaurant, in den Gärten und der Hydrokultur-Anlage, auf dem Flugplatz und wo immer sie sonst noch gebraucht werden. Ihre Freundlichkeit macht die Insel für uns zu einem kleinen „Land des Lächelns“.
Dass uns das Lächeln nicht vergeht, dafür sorgt auch die Hilfsbereitschaft einiger Amerikaner: Toby zum Beispiel schweißt mit seinem Thai-Gehilfen Poem nicht nur das Auspuffrohr, sondern baut auch gleich noch eine solide Aufhängung dafür im Maschinenraum. Tracy, die Leiterin des Besucherzentrums (wir sind derzeit die einzigen Besucher) ist eine kompetente Ansprechpartnerin in Sachen Naturschutz, Vögel und Meerestiere und bleibt kaum eine Antwort auf unsere vielen Fragen schuldig. Und wie dankbar bin ich Darlin, der gewichtigen Eskimodame aus Anchorage, dass sie uns zum Flugplatz begleitet, um uns dort einen ganz besonderen Gast vorzustellen, falls er nicht gerade ausgeflogen ist. Wir haben Glück und entdecken ihn nach einigem Suchen: Wie ein einzelner Löwenzahn auf einer Wiese voller Gänseblümchen ragt er dort aus den Laysans, die neben der Rollbahn nisten. Der Supervogel ist ein weiblicher Kurzschwanz-Albatros, deutlich größer als seine Verwandten, mit goldgelbem Kopfgefieder und gewaltigem, hellrosa Schnabel. Als einzige Vertreterin einer sehr seltenen Art, die bisher nur auf der japanischen Vulkaninsel Tori-shima brütet und mit einer Gesamtpopulation von rund 60 Paaren angegeben wird, ist sie auf Midway eine echte ornithologische Sensation. Ihr scheint das weniger zu gefallen: Ziemlich verloren sitzt sie auf einem verlassenen Laysan-Ei und wartet seit vielen Wochen auf ihren Partner. Der müsste schon lange da sein. Lost at sea?
Blutzoll und Plastiksuppe
Bisher haben die Albatrosse alle menschlichen Eingriffe überlebt: Zuerst die japanischen Feder- und Eiersammler, dann die „Pacific Cable Companie“, die 1903 von Midway aus einen Teil des weltumspannenden Kabel-Kommunikationssystems installierte, als Nächstes die „Trans Pacific Flying Clipper“-Wasserflugzeuge der „Pan American Airlines“ in den 1930ern und selbst den Zweiten Weltkrieg mit der Auftankstation für die amerikanischen U-Boote und der Schlacht um Midway. Noch bis 1996 haben sie ihren Brutplatz mit 3000 hier stationierten Marinesoldaten geteilt, und bis heute ertragen sie die Rollbahn und den Tower, obwohl diese einen ständigen Blutzoll von ihnen fordern.Doch verglichen damit sind die Herausforderungen, denen sie nun ausgesetzt sind, viel gewaltiger und zudem allgegenwärtig! Denn selbst an einem so entlegenen Winkel der Erde, in dem nun, nach Abzug des Militärs, scheinbar alles wieder einen paradiesischen Gang nimmt, greift der lange Arm der menschlichen Zivilisation ein: durch den Klimawandel, der besonders diese flachen Riffinseln bedroht, durch die Longline-Fischerei, falls diese Praktiken nicht bald geändert werden, und durch die wachsende Verschmutzung der Meere.
Expeditionen und wissenschaftliche Untersuchungen haben in jüngster Zeit eine kreisförmige Strömung zwischen Nordamerika und Asien nachgewiesen, in deren Zentrum die Hawaiikette liegt. In diesem Wirbel, der von der Erdrotation und den Winden in Gang gehalten wird, zirkulieren zig Millionen Tonnen an Kunststoffmüll oft jahrelang wie in einem Karussell, bis sie schließlich nach und nach von anderen Strömungen erfasst und weiterverteilt werden. „Great Pacific Garbage Patch“ nennen Experten diese Plastiksuppe.
Die Strände auf Midway gleichen einer Mülldeponie. Hier wird neben toten Robben und strangulierten Seevögeln alles angeschwemmt, was Menschen ins Meer werfen oder was über Bord fällt: vor allem Nylonnetze, Schwimmkörper von Netzen, Angelhaken, Angelleinen, Angelruten, Zahnbürsten, Kämme, Verschlusskappen, Flaschen, Feuerzeuge, Kugelschreiber, Sandschippchen, Badetiere, Golfbälle, Töpfe, Eimer, Yoghurtbecher, Plastikringe von Bierdosen-Sixpacks, CD-Hüllen, CDs, sogar Fernseher und Kühlschränke. Einen ganzen Haushalt könnte man sich zusammensuchen und gleich noch eine Anglerausstattung dazu.
Volontäre sammeln vieles ein, aber man bräuchte eine ganze Kompanie, um die Strände fortwährend zu säubern. Und nicht nur die See spült den Plastikmüll an. Auch die Albatrosse bringen Kunststoff auf die Insel, nach Schätzung der Biologen jedes Jahr etwa fünf Tonnen, und zwar als Futter für ihre Jungen. Seit Millionen von Jahren sammeln sie von der Meeresoberfläche auf, was dort schwimmt. Sie haben nicht gelernt, Plastikstücke von ihrer normalen Nahrung, den Tintenfischen, zu unterscheiden. Lässt der Kunststoffanteil im Futter es zu, dass die Jungen die ersten Monate überleben, dann sind sie auch meist imstande, die unverdaulichen Reste als „Gewölle“ auszuwürgen. Normalerweise sind das Tintenfischschnäbel, nun aber sind es auch bunte, metallisch-schillernde Feuerzeuge, Kugelschreiber, Spielzeugfiguren, Verschlusskappen, Zahnbürsten usw. Die ganze Insel ist dann übersät damit. Im „Visitor Center“ sind neben besonders skurrilen Artefakten aus solchen Gewöllen auch Röntgenaufnahmen von Albatrossen ausgestellt, deren Bauchraum von Feuerzeugen ausgefüllt ist. Auch wir entdecken viele tote Jungvögel. Doch das „große Sterben“ beginnt erst noch, wenn die Tiere etwas älter sind. Laut Tracy verenden 30 bis 40 Prozent vom Nachwuchs in jeder Saison.
Die Freydis ist kein wissenschaftliches Expeditionsschiff, wir machen keine mikroskopischen oder chemischen Untersuchungen. Trotzdem ist uns in den 40 Jahren, in denen wir durch die Weltmeere segeln, nicht verborgen geblieben, dass Strömungen dafür sorgen, dass Müll und Giftstoffe, wo immer sie ins Meer gelangen, über die ganze Erde verteilt werden und am Ende wieder bei uns landen. Ein kleiner Zeuge davon sitzt in meiner Vitrine: eines von 20 000 in Japan über Bord gegangener Plastik-Entchen, das wir an einem einsamen Strand in Alaska fanden.
Obwohl zurzeit das Bild der Insel von den Albatrossen geprägt wird, entdecken wir hier auch viele andere Vogelarten. Einige ruhen sich von der Wanderschaft aus, andere gehen ihrem Brutgeschäft nach. Als wir das erste Mal nach Sonnenuntergang zu Fuß vom Clipper House zur Freydis zurückgingen, bekamen wir einen ganz schönen Schrecken. Plötzlich verdüsterte sich der Himmel über uns und die Luft war voller dahinhuschender, -gleitender, -flatternder, -zwitschernder Schatten. Nun wissen wir’s: Es sind Sturmvögel – genauer gesagt Bonin-Sturmvögel mit einer Spannweite von immerhin 70 cm –, die jeden Abend von ihrem Tag auf See zurückkehren. Sobald sie gelandet und in ihren unterirdischen Höhlen verschwunden sind, endet das Spektakel so rasch, wie es begonnen hat.
Auch andere Meerestiere suchen die Insel auf. Wenn wir mittags durch den Casuarinen-Hain zur Old Seaplane Ramp schlendern, können wir meist ein paar Hawaii-Mönchsrobben bewundern, die sich von ihrer nächtlichen Jagd darauf ausruhen. Der angrenzende Strand ist dagegen der Lieblingsplatz Grüner Meerschildkröten, die sich dort gern in der Sonne wärmen. Ganz besonders schön ist es, frühmorgens die Spinner-Delphine am Hafen vorbei in die Lagune zurückkehren zu sehen. Dann vergesse ich oft, dass wir doch nach Japan wollen …
Schweren Herzens bereiten wir uns nach acht Tagen darauf vor, dieses lebenspralle Fleckchen Erde zu verlassen. Die Wetterprognose, die wir im Internet abfragten, ist günstig. Zwar bildet sich ein starkes Tief in Japan, aber Japan ist noch weit.
Doch dann müssen wir noch zwei Tage anhängen: Ein Albatros hat unsere Mastspitze gestreift, dabei Topplicht und Windex zerstört und die UKW-Antenne verbogen. Die Kollision hat er zwar ohne Schaden überstanden, am Morgen aber wandert er ziemlich rastlos-ratlos schnabelklappernd an Deck umher: Er muss Futter für sein Junges holen, aber wie soll er hier abheben? Als ihm Erich den Schnabel zuhält und ihn ins Wasser gleiten lässt, paddelt er eilig aus der Bucht und startet anschließend gegen den Wind.
Bei uns liegen die Dinge nicht so einfach: Erich muss in die Mastspitze und die schadhaften Teile herunterholen. Die UKW-Antenne lässt sich zum Glück aufrichten. Dann müssen wir eine provisorische Topplampe basteln – ein leeres Nescafé-Glas leistet uns dabei gute Dienste – und den Reserve-Windex auskramen.
Und damit die Albatrosse in der Nacht unsere Arbeit nicht wieder zunichte machen, klettert Erich erst am Morgen, kurz vor dem Auslaufen, ein zweites Mal in die Mastspitze. Dann laufen wir aus. Kurs SSW, um dem Sturmtief auszuweichen, das sich nun doch von Japan her nähert.

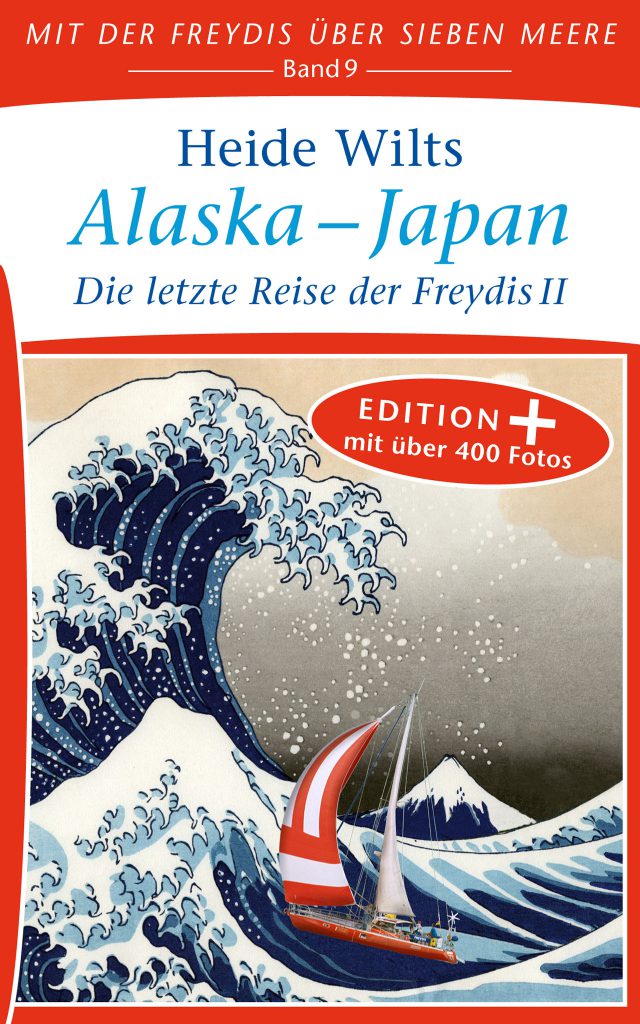








 Blauwasser.de – Judith und Sönke Roever
Blauwasser.de – Judith und Sönke Roever Literaturboot.de – Detlef Jens
Literaturboot.de – Detlef Jens